Aleksander Janollari
In Serbien protestieren seit Monaten täglich zehntausende Menschen gegen die Regierung. Was ursprünglich als Studentenprotest begann, hat sich mittlerweile zu einer der größten landesweiten Bewegungen seit dem Sturz von Slobodan Milošević im Jahr 2000 entwickelt und erreicht das Ausmaß einer der größten Studentenbewegungen Europas seit 1968.
Der Auslöser für die Proteste war der Zusammenbruch des Dachs eines neu gebauten Bahnhofs in Novi Sad am 1. November 2024, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen. Die Protestierenden sehen Korruption und das Versagen des Staates als die wahren Ursachen der Katastrophe, die auf Baumängeln beruhten. Seitdem die Serbische Fortschrittspartei (SNS) 2012 an die Macht kam, hat die Missachtung demokratischer Prinzipien und der Rechtsstaatlichkeit in Serbien zugenommen und ist zu einem klassischen Beispiel für Staatsgeiselnahme geworden. Die Studenten und ihre Unterstützer fordern nicht nur den Rücktritt der Regierung oder den Austausch einzelner Politiker, sondern auch die grundlegende Umsetzung der Rechtsstaatlichkeit. Korrupten Politikern und kriminellen Clans müsse endlich der Prozess gemacht werden, so ihre Forderung. Präsident Aleksandar Vučić, der das Land seit über einem Jahrzehnt dominiert, steht im Zentrum der Kritik: Medienkonzentration, Einschränkung der Pressefreiheit, Einflussnahme auf die Justiz und ein Netz aus Loyalitäten, das demokratische Kontrolle untergräbt.
Was sich derzeit auf den Straßen Belgrads, Niš’ und Novi Sads entfaltet, ist weit mehr als eine bloße Protestwelle – es ist ein Aufbruch, ein kollektiver Ruf nach einer anderen Zukunft. Inmitten einer Atmosphäre politischer Resignation erhebt sich eine Generation, die sich nicht länger mit der Dialektik von Autokratie und Scheinpluralismus abfinden will. Ihre Forderungen gehen über den Sturz Einzelner hinaus; sie zielen auf einen strukturellen Wandel, auf die Wiederherstellung eines Staates, der seinen Bürgern dient – nicht einem Machtkartell. Die Proteste haben in Serbien nicht nur die politische Elite unter Druck gesetzt, sondern auch die Wahrnehmung der Regierung auf internationaler Ebene verändert. Während die EU lange Zeit eine passive Haltung gegenüber den autoritären Tendenzen unter Vučić einnahm, wird der Druck der Straße zunehmend als Symbol für den Widerstand gegen diese Praxis wahrgenommen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dies zu einer wirklichen Veränderung der Haltung der EU gegenüber Serbien führen wird. Die EU scheint vorerst weiterhin auf Stabilität bedacht zu sein, was die Unterstützung für Vučićs Regierung betrifft. Dennoch haben die Proteste bereits konkrete politische Reaktionen hervorgerufen: Der Rücktritt von Premierminister Miloš Vučević im Februar 2025 zeigte, dass der Druck der Straße Wirkung zeigt, auch wenn er von vielen nicht als ernsthafte politische Erneuerung wahrgenommen wurde. Vielmehr wurde Vučević als „taktisches Opfer“ geopfert, um die breitere politische Struktur der Regierung Vučićs nicht zu gefährden. Die breite gesellschaftliche Unterstützung für die Proteste, vor allem unter den Jugendlichen, hat jedoch das Potenzial, langfristige Veränderungen in der politischen Kultur Serbiens zu bewirken. Die Bewegung fordert nicht nur die Absetzung von Politikern, sondern auch tiefgreifende institutionelle Reformen, die den Rechtsstaat und die demokratischen Prinzipien wiederherstellen
sollen. Diese Forderungen haben in Teilen der Bevölkerung, insbesondere unter den urbanen und jüngeren Generationen, starke Resonanz gefunden.
Ob diese Bewegung in der Lage sein wird, das bestehende Gefüge zu erschüttern, bleibt offen. Doch bereits jetzt hat sie etwas Entscheidendes vollbracht: Sie hat das Monopol der Macht auf das Narrativ der Zukunft infrage gestellt. Der Widerstand ist zur Sprache eines anderen Serbiens geworden – eines Serbiens, das sich nach Gerechtigkeit, Transparenz und europäischer Normalität sehnt, ohne seine Identität aufzugeben.
Die kommenden Monate werden zeigen, ob aus der moralischen Erschütterung ein politischer Wandel erwächst. Die EU steht dabei vor einer eigenen Bewährungsprobe: Wird sie sich weiterhin hinter stabilitätsorientierter Rhetorik verstecken – oder die demokratischen Impulse, die aus der Zivilgesellschaft kommen, ernst nehmen und unterstützen? Eines jedoch ist gewiss: Die Bewegung hat die politische Landschaft Serbiens bereits verändert. Selbst wenn sie institutionell scheitert, hat sie einen Bruch markiert – mit der Gleichgültigkeit, mit der politischen Apathie, mit der Akzeptanz des autoritären Status quo. Und in diesem Bruch liegt Hoffnung – nicht als fertige Antwort, sondern als offene Möglichkeit.

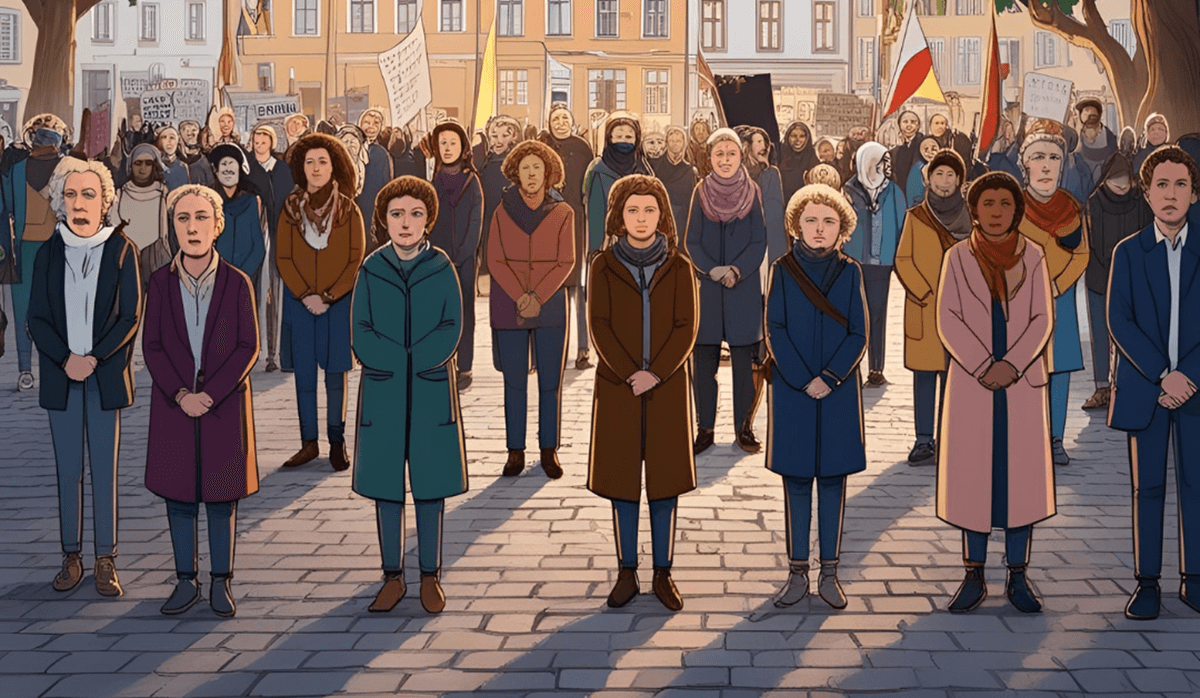
![“Der Krieg in der Ukraine hat alle militärischen Schwächen […] der EU zur Schau gestellt”](https://www.fomoso.org/wp-content/uploads/2024/07/Firefly-Ukraine-debate-dual-politics-7023-500x383.jpg)

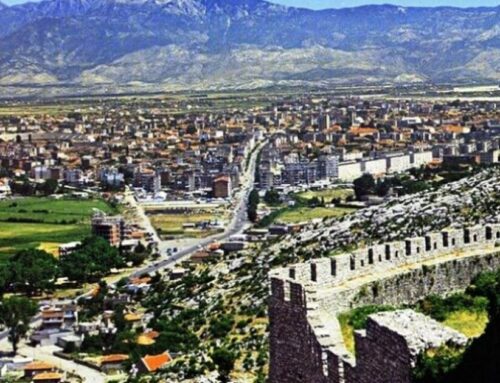
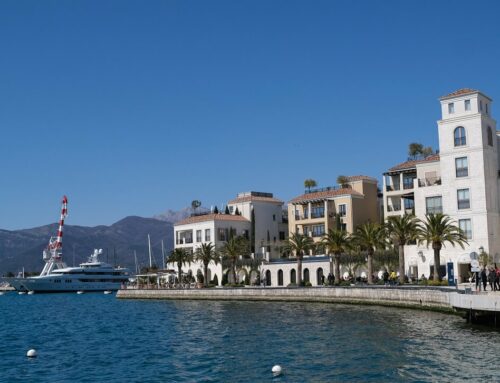
Hinterlasse einen Kommentar